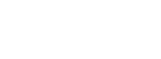Kommunikation
Kurseinheit 1 - Grundlagen der Kommunikation
Wenn es um Kommunikation geht, denken die meisten Menschen zunächst an Sprache und man muss schon sagen: Beim Thema Sprache haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt. Weltweit gibt es ca. 7000 lebendige Sprachen. Die deutsche Sprache allein umfasst etwa 75.000 Wörter. Sind Sie Muttersprachler befinden sich davon 12.000 – 16.000 auch in Ihrem aktiven Wortschatz.
Es ist unsere hochentwickelte Sprachfähigkeit, die unsere Kommunikation von der aller anderen Spezies unterscheidet und die in ihrer Funktionalität das Miteinander in jeder Beziehung vereinfacht.
So viele Möglichkeiten – und doch erleben wir in unserer PRAXIS AN DEN SAUMSEEN fast täglich Paare, die über Kommunikationsprobleme klagen. Die dysfunktionale Kommunikation in ihrer Partnerschaft macht das Miteinander kompliziert und manchmal sogar unmöglich.
Es mag auf den ersten Blick so scheinen, als sei Kommunikation fast immer der Auslöser für Probleme. Wir als Experten aber wissen – sie ist auch fast immer die Lösung! Dieses Paradox wollen wir in dieser Kurseinheit für Sie auflösen.
Willkommen
Herzlich willkommen zur Kurseinheit GRUNDLAGEN DER KOMMUNIKATION Ihres Onlinekurses IMPULSE FÜR DIE LIEBE.
Mit diesem Onlinekurs ….
Wir schicken Sie auf die Reise … In den nächsten x Wochen …
Jede Kurseinheit setzt sich zusammen aus einem Informationsteil und zahlreichen Übungen. Eine …. mit Fakten und Downloads zum aktuellen Wochenthema runden die Kurseinheit ab. Ein Quiz am Ende …..
So verbessern Sie, Schritt für Schritt, die Kommunikation in Ihrer Beziehung.

Kommunikation – lateinisch communicatio „Mitteilung“
Wortart: Substantiv, feminin
Lautschrift: [kɔmunikaˈt͡si̯oːn]
Bedeutung:
Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr besonders mithilfe von Sprache oder Zeichen
Was ist Kommunikation?
Der Begriff Kommunikation beschreibt jeden Versuch, auf verbale, nonverbale, paraverbale, akustische oder optische Art und Weise mittels Sprache, Mimik, Gestik, Intonation oder Gestaltung Informationen zwischen Individuen weiterzugeben.
Informationen sind in diesem Zusammenhang jede Form von Daten, also Wissen, Erkenntnisse, Erfahrungen, Gedanken, Vorstellungen, Meinungen oder Empfindungen.
Zur wissenschaftlichen Betrachtung der Kommunikation wurden verschiedene Kommunikationsmodelle entwickelt.
Die sieben populärsten Kommunikationsmodelle
DAS SENDER/EMPFÄNGER - MODELL
Das von Claude E. Shannon und Warren Weaver entwickelte Modell konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente der Kommunikation.
Der SENDER repräsentiert die Ausdrucksseite. Seine Aufgabe ist die Informationsproduktion. Er codiert seine MESSAGE in ein SIGNAL (Sprache, Schrift, …).
Der EMPFÄNGER auf der Eindrucksseite nimmt dieses SIGNAL durch Rezeptionsinstrumente (Ohren, Augen, ..) wieder auf und decodiert durch Interpretation die übertragene Botschaft.
DAS ORGANON - MODELL
Der Sprachpsychologe Karl Bühler stellte die Bedeutung der menschlichen Sprache als Werkzeug der Kommunikation in den Mittelpunkt seines ORGANON* – Modells.
Dieses Werkzeug bietet dem SENDER drei Funktionen, die er zum Austausch von Daten mit dem EMPFÄNGER nutzen kann.
Ausdrucksfunktion: Der Sender drückt gegenüber dem Empfänger ein Symptom aus, ohne dies direkt zu benennen.
Darstellungsfunktion: Der Sender teilt eine Tatsache so neutral und realitätsgetreu wie möglich mit.
Die Appellfunktion richtet eine eine konkrete Aufforderung an den Empfänger, auf die Information des Senders zu reagieren.
Beispiel: Nehmen wir an, der Sender hat großen Hunger.
Im Modus der Darstellungsfunktion sagt er z.B. „Das Restaurant gegenüber bietet um diese Zeit einen Mittagstisch mit Getränk für 9.90€.“
*Organon, griech. „Werkzeug“
Appellfunktion: Dieses letzte Zeichen beinhaltet eine Aufforderung, sodass der Empfänger auf eine gewisse Art und Weise reagiert. Das kann zum Beispiel eine Aufforderung sein („Hole mir etwas zu essen“) oder aber auch eine Feststellung, die durch den Empfänger interpretiert wird („Dort könnten wir etwas essen“).“ https://blog.hubspot.de/sales/kommunikationsmodelle#organon-modell
Eintrag #3
Das Sender/Empfänger - Modell
Darin übernimmt der Sender als Ausdrucksseite die Aufgabe der Informationsproduktion (Sprechen, Schreiben, … ), der Empfänger als Eindrucksseite die der Informationsrezeption (Hören, Lesen, …).
„Nie hörst du mir zu!” – “Das habe ich so nicht gesagt.” – “Das habe ich so nicht gemeint.”
Kennen Sie das? Solche und ähnliche Sätze fallen früher oder später in jeder Beziehung. Das Paar spricht dann von Kommunikationsproblemen. Begeben wir uns doch einmal auf die Suche nach deren Ursachen.
Aus einem – zunächst nur ihm bekannten Motiv heraus – beschließt der Sender, Daten an einen oder mehrere Empfänger zu übermitteln. Er verfolgt mit diesem Handeln einerseits eine bestimmte Absicht, die die Sprachwissenschaft Kommunikationszweck nennt. Typische Kommunikationszwecke sind z.B. das Herstellen einer Übereinkunft oder der Abgleich der eigenen Bedürfnisstruktur mit der des Empfängers.
Das Kommunikationsziel ist Verständigung. (Ebene der Es muss zunächst einmal verstanden werden, worum es in einem Kommunikationsprozess geht. Sich zu verständigen bedeutet, eine in der Situation ausreichende Kompatibilität von Erfahrungen bezüglich eines Themas herzustellen.
Andererseits übermittelt er seine Daten auch zu einem bestimmten Kommunikationszweck, z.B.
Nach dem Austausch erfolgt beim Empfänger deren Interpretation. Diese Interpretation erfolgt auf zwei Ebenen, die in der Sprachwissenschaft als Kommunikationsziel und Kommunikationszweck beschrieben werden.
Mit anderen Worten – der Empfänger der Daten sucht einerseits nach dem Inhalt der übermittelten Daten und andererseits nach dem Grund der Datenübermittlung. Der erste Bereich betrifft das kommunikative Handeln, der zweite Bereich die Folgen des kommunikativen Handelns. In beiden Bereichen kann es zu Problemen kommen.
Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt:
Um zu verstehen, wie Probleme auf der Ebene in der Kommunikation entstehen ist es notwendig, einen weiteren Begriff einzuführen: den der Wahrheitskonstruktion.
Probleme der Kommunikation entstehen unter anderem durch kulturelle Differenzen. Diese Differenzen bestehen als Unterschiede in der Art und Weise, die Wirklichkeit zu deuten und andere Menschen zu beurteilen. Ein oft angeführtes Beispiel ist die Wahrnehmung von Kopfbewegungen als Zustimmung oder Ablehnung, die in verschiedenen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt ist (Kopfschütteln kann Zustimmung bedeuten). Ein Beispiel für kulturelle Differenzen im wirtschaftlichen Bereich ist die unterschiedliche Beurteilung dessen, was z.B. bei einem Geschäftsessen als höflich oder unhöflich, angemessen oder unangemessen gilt. Im Speziellen lassen sich interkulturelle Kommunikationsprobleme auf Unterschiede in der Sozialisierung, im Bildungsstand oder in der individuellen Welttheorie zurückführen. Interkulturelle Differenzen bestehen auch innerhalb von Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft.
Probleme der Kommunikation können schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen haben. Dies wird insbesondere im Zusammenhang mit der Globalisierung deutlich. Genauere Angaben über den wirtschaftlichen Schaden, der durch Probleme in der Kommunikation mitverursacht wird, lassen sich schwer machen. Die Berufsfelder, die sich mit Problemen der Kommunikation aus unterschiedlichen Themenzugängen auseinandersetzen, wie Coaching, Kommunikationstraining, Organisationsplanung, Qualitätsmanagement, Beratung (Consulting), Mediation, Psychologie u.a.m. und deren inhaltliche Zuständigkeit zu konkreten Problemstellungen zu erkennen, ist für „Hilfesuchende“ häufig eine Herausforderung.
er Ebene der Verständigung und der Ebene übergeordneter Probleme
In Bezug auf menschliche Kommunikation lassen sich zwei Ebenen (Perspektiven) der Problemstellung und Problemlösung unterscheiden, die als Kommunikationsziel und Kommunikationszweck beschrieben werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass Problemstellung und Problemlösung an sich nichts Negatives sind, sondern essentieller Bestandteil der Lebensführung. In dieser Betrachtung findet auch auf einer Party kommunikative Problemlösung statt, und zwar: nicht allein zu sein, Partner zu finden, Freude zu haben. Diese Sichtweise bedeutet allerdings auch, dass es bei dem Thema Kommunikationsprobleme um eine weitere Perspektive und um eine mehrfache Verwendung des Problembegriffs geht: Es geht um die Perspektive auf Probleme, die ihrerseits die Prozesse der Problemlösung durch Kommunikation behindern.
Das Kommunikationsziel ist Verständigung. Es muss zunächst einmal verstanden werden, worum es in einem Kommunikationsprozess geht. Sich zu verständigen bedeutet, eine in der Situation ausreichende Kompatibilität von Erfahrungen bezüglich eines Themas herzustellen. Dieser Vorgang wird seinerseits als Problemlösung angesehen. Erst auf der Basis von Verständigung können Kommunikationszwecke erreicht werden, das heißt es können übergeordnete Probleme gelöst werden. Beispiele für übergeordnete Kommunikationszwecke sind: gemeinsames Verrichten von Arbeit, die Organisation einer Veranstaltung, aber auch komplexe soziale Probleme wie das Verändern von Überzeugungen, Stabilisieren der eigenen Persönlichkeit, Lügen, Handlungsbeeinflussung, Machtausübung.
Die Beurteilung eines Kommunikationsprozesses als erfolgreich oder nicht (Die Zuschreibung von Kommunikationserfolg) betrifft beide Ebenen.
Ebene der Verständigung (Kommunikationsziel)
Probleme der Kommunikation auf der Ebene der Verständigung sind Hindernisse, die die Verwendung und Deutung von Zeichen und damit das Herstellen von Kompatibilität (Verträglichkeit, zueinander Passen) von Erfahrungen behindern. Dazu gehören neben allgemeinen Sprachbarrieren auch leibliche Bedingungen wie Intentionalität, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, die Ausrichtung auf den Anderen, die Bereitschaft, seine Gedanken dem Anderen zu unterwerfen (zuhören können), die Einordnung des Verstandenen in das eigene Verständnis von der Welt (die individuelle Welttheorie). Diese Probleme sind Gegenstand interdisziplinärer kommunikationswissenschaftlicher Forschung. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Kommunizierende über ein Wissen von diesen Hindernissen verfügt, das er situationsbezogen, flexibel und zu einem hohen Grad unbewusst anwendet.
Bei näherer Überlegung kann davon ausgegangen werden, dass Verständigung in vielen Kommunikationssituationen problematisch wird. Viele Kommunikationsprozesse sind Kontrolldialoge, das heißt sie dienen dazu, Verständnis zu überprüfen und Missverständnisse zu beheben, sofern sie festgestellt wurden. Militärische Kommunikation ist ein Extrembeispiel dafür, wie Kommunikation eingeschränkt wird, um folgenschwere Missverständnisse zu vermeiden. Schulen, Universitäten, Seminare und Fortbildungen sind ein weiteres Beispiel dafür, dass Verständigung über ein komplexes Thema zu Beginn nicht funktioniert, weil beispielsweise die gemeinsame Begriffsklärung fehlt.
Eine Möglichkeit zur Vorbeugung gegen Missverständnisse wird als Paraphrasierung bezeichnet. Etwas zu paraphrasieren bedeutet, das Gemeinte in verschiedenen Formulierungen zu sagen und auf diese Weise genauer einzugrenzen.
Ebene der übergeordneten Problemstellungen (Kommunikationszweck)
Wenn übergeordnete Kommunikationszwecke (z. B. Überreden und Überzeugen, das Ändern von Überzeugungen, eine Zusammenarbeit im Team) nicht erreicht werden, wird dies häufig auch auf Kommunikation zurückgeführt. Hier muss unterschieden werden, inwiefern die übergeordneten Probleme durch Missverständigung oder durch andere übergeordnete Faktoren zustande gekommen sind. Bei Misserfolgen auf diesen übergeordneten Ebenen spielen Faktoren eine Rolle, die nicht alle auf Kommunikationsprozesse zurückgeführt werden können. In diesem Zusammenhang geht es häufig auch darum, ob Kommunikation überhaupt zustande kommt oder nicht; das heißt, ein Kommunikationsproblem kann darin bestehen, dass in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Situation überhaupt nicht kommuniziert wird.
Lügen und Probleme der Kommunikation
Eine Lüge kann als absichtliche Täuschung angesehen werden. Mit einer Lüge wird der Kommunikationszweck verfolgt, dass der andere etwas glaubt, von dem der Lügende weiß, dass es so nicht stimmt. Dazu muss der Kommunikationspartner die Formulierungen des Lügenden verstehen. Er muss zuerst im Sinne der Bedeutungskonstruktion dasjenige verstehen, was er glauben soll. Voraussetzung für das Erreichen des Kommunikationszwecks der Lüge (die absichtliche Täuschung des anderen) bedeutet in dieser Sichtweise, auf der Ebene der Verständigung (des Kommunikationsziels) erfolgreich kommunikativ zu handeln. Verständigung wird in diesen Erläuterungen unabhängig von einer Wahrheitsproblematik gesehen.15
Mit Lügen können übergeordnete Probleme geschaffen und verstärkt, aber auch vermieden oder gelöst werden. Dies kann auch für denjenigen gelten, der angelogen wird oder angelogen werden möchte. Das Thema wird auch in der Literatur behandelt.16
Kommunikation – lateinisch communicatio „Mitteilung“
Wortart: Substantiv, feminin
Lautschrift: [kɔmunikaˈt͡si̯oːn]
Bedeutung:
Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr besonders mithilfe von Sprache oder Zeichen
Das primäre Ziel von Kommunikation ist die Verständigung.
Informationen sind in diesem Zusammenhang jede Form von Wissen, Erkenntnissen, Erfahrungen, Gedanken, Vorstellungen, Meinungen oder Empfindungen.
Durch Kommunikation findet ein Austausch des Informationsträgers statt, denn die Informationen werden von einem Individuum auf ein anderes übertragen.
Zur wissenschaftlichen Betrachtung der Kommunikation wurden verschiedene Kommunikationsmodelle entwickelt. Eines der bekanntesten ist das Sender/Empfänger-Modell.
Darin übernimmt der Sender als Ausdrucksseite die Aufgabe der Informationsproduktion (Sprechen, Schreiben, … ), der Empfänger als Eindrucksseite die der Informationsrezeption (Hören, Lesen, …).
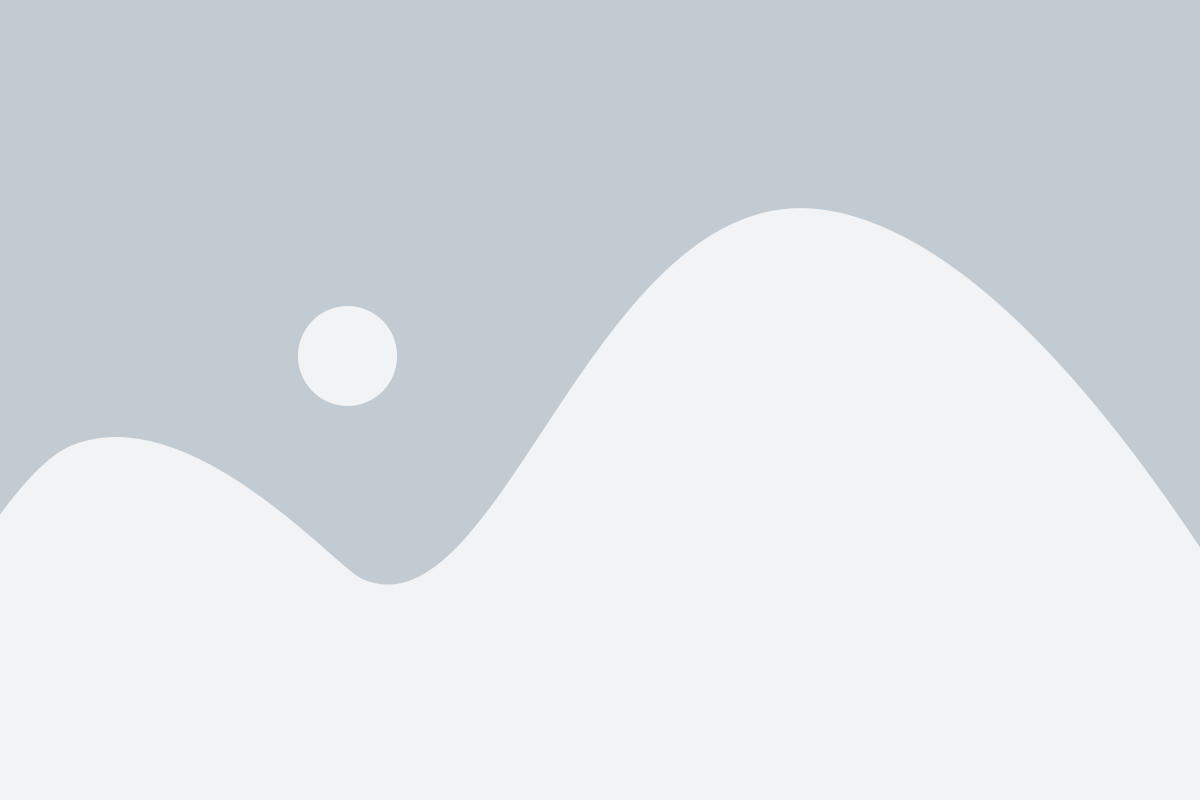
Die Wahrheitskonstruktion ist ein Theorem der konstruktivistischen Kommunikationstheorie.
Die Deutung der durch Informationsaustausch von einer Person zur anderen gereichten Daten erfolgt nach der Wahrnehmung durch die Sinne des Empfängers auf Basis seiner Erfahrungen und seines Wissens.
Erfahrung, Wissen und Wahrnehmungsfähigkeit durch die Sinnesorgane variieren von Person zu Person, sie sind also rein subjektiv. Erkenntnisse, die auf einer subjektiven Basis gewonnen werden, können nicht zu objektiven Wahrheiten führen. Jeder Mensch erschafft also in der Kommunikation mit anderen seine eigene Wahrheitskonstruktion.
Als Begründer des radikalen Konstruktivismus gilt Ernst von Glasersfeld. Weitere wichtige Vertreter sind der Soziologe Heinz von Foerster und die Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela.
Der Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick leitete daraus ein weniger radikales Modell ab, das zwischen der Wirklichkeit der 1. Ordnung, die unumstößliche Tatsachen wie z.B. physikalische Gesetzte enthält und der Wirklichkeit der 2. Ordnung , die auf rein subjektiven Annahmen beruht, unterscheidet. Der Konstruktivismus ist ein Basiselement der Systemik.